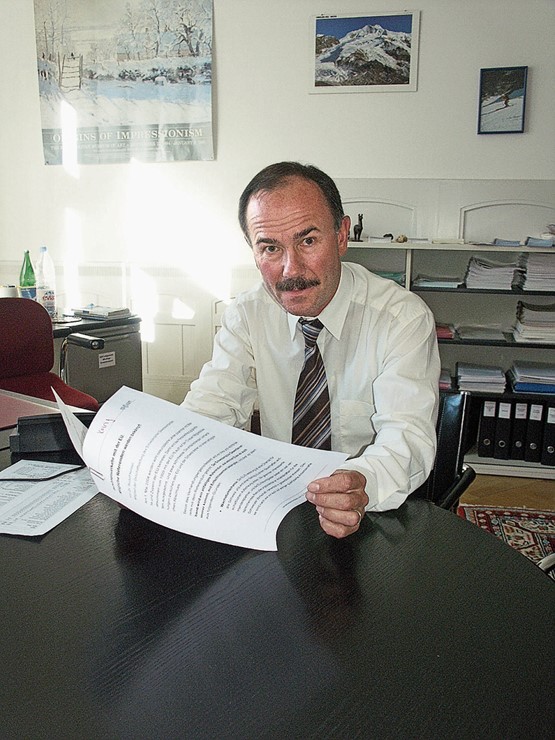Der präsentierte Fahrplan für AHV 2030 reicht nicht: Wirtschaftsverbände unterstützen den Vorstoss für eine unabhängige Expertengruppe
Nicht abschaffen, aber reformieren
ANTIRASSISMUS-KOMMISSION – Während vielen Jahren vertrat der ehemalige sgv--Ökonom Ruedi Horber den SchweizerischenGewerbeverband in der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus (EKR). Nun, mit über 70, ist für Horber Ende 2023 Schluss. Und damit Zeit für eine Bilanz. Braucht es die EKR überhaupt noch, oder gehört sie abgeschafft?
Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus EKR polarisiert wie kaum eine andere Instanz des Bundes. Linke und «Gutmenschen» möchten eine noch aktivere und bissigere Kommission. Ganz anders rechtsbürgerliche Kreise: Sie nehmen die EKR als bevormundend wahr und fordern immer wieder deren Abschaffung. Bevor ich eine kritische Schlussbilanz ziehe, seien kurz die Grundlagen und das Mandat in Erinnerung gerufen.
Die umstrittene Antirassismus-Strafnorm
Kaum ein Artikel des Schweizerischen Strafgesetzbuches StGB gibt zu so vielen Diskussionen Anlass wie Art. 261bis. Dieser Artikel stellt Handlungen unter Strafen, mit denen Menschen aufgrund ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung in der Öffentlichkeit diskriminiert werden oder wenn Völkermord, namentlich der Holocaust, geleugnet oder verharmlost wird. Strafbar sind zudem rassendiskriminierende Verweigerungen von Waren- und Dienstleistungen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind. Es sind Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren oder Geldbussen vorgesehen.
«Kritische, fakten-basierte Bemerkungen, beispielsweise zur hohen Ausländer-kriminalität, waren und sind in der EKR unerwünscht.»
Ein Blick in die Datenbank «Sammlung Rechtsfälle» zeigt, dass es zwar immer wieder zu Anklagen kommt, die rechtskräftigen Verurteilungen mit durchschnittlich etwas über 20 pro Jahr sich jedoch in engen Grenzen halten. Meistens sind es milde Urteile, nur bedingte Geldstrafen von wenigen hundert Franken.
Die EKR wurde vom Bundesrat 1995 nach der Annahme der Antirassismus-Strafnorm Art. 261bis StGB eingesetzt und besteht aus 15 Mitgliedern sowie einem dem Generalsekretariat des Innendepartementes angegliederten Sekretariat. Laut Mandat des Bundesrates vom 23. August 1995 «befasst sich die EKR mit Rassendiskriminierung, fördert eine bessere Verständigung zwischen Personen unterschiedlicher Rasse, Hautfarbe, nationaler und ethnischer Herkunft, Religion, bekämpft jegliche Form von direkter und indirekter Rassendiskriminierung und schenkt einer wirksamen Prävention besondere Beachtung.»
Folgerichtig sind die Haupttätigkeitsfelder der EKR, die sich in der Regel jährlich zu fünf Sitzungen trifft, Prävention und Sensibilisierung, Analyse, Forschung und Monitoring, Information, Beratung und Expertise sowie Öffentlichkeitsarbeit und Empfehlungen, z.B. zu Volksabstimmungen wie der Ausschaffungs-, Minarett- oder Burkainitiative.
Drei Hauptkritikpunkte
Die Arbeiten der EKR orientieren sich durchaus am bundesrätlichen Mandat. Es gibt jedoch Handlungsbedarf, und zwar vor allem in drei Bereichen:
• Einseitige Zusammensetzung der EKR: In der Kommission dominieren die eher links gerichteten Kräfte, die bürgerlichen Vertreter und wirtschaftsnahe Kreise sind klar untervertreten. Ich war mit meinen oftmals kritischen Positionen gegen zu viel Aktivismus vielfach allein auf weiter Flur. Es braucht in der EKR unbedingt noch einen Vertreter einer Organisation, die sich prononciert für die Meinungsäusserungsfreiheit in der Schweiz und gegen immer mehr «Maulkörbe» und Denkverbote einsetzt, z.B. des Liberalen Instituts oder der IG Freiheit.
• Verzettelung der Ressourcen: Die EKR beschäftigt sich mit zu vielen Themen. Mehr Konzentration auf das Kerngeschäft wie krasser und offensichtlicher Rassismus gegen Schwarze, Antisemitismus von rechts und von links sowie Schutz besonders verletzlicher Minderheiten wäre wünschenswert. Leider verschwendet die EKR ihre knappen Ressourcen immer wieder mit modischen Nebenthemen wie der kulturellen Aneignung, dem fragwürdigen Kampf gegen nicht mehr genehme Bezeichnungen wie dem Mohrenkopf und der Entfernung von Denkmälern mit angeblichen Rassisten aus der Vergangenheit.
• Wenig Bodenhaftung, keine kritische Diskussionskultur: Die Diskussionen finden in der Regel auf einer eher akademischen und abstrakten Ebene statt, man ist unter seinesgleichen. «Struktureller Rassismus», «Racial Profiling»: Mit solchen Begriffen holt man die Politik und das Volk nicht ab. «Behandle jeden Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest» – diese Botschaft wäre viel verständlicher und wirkungsvoller. Zudem findet leider kaum ein Dialog mit der Politik statt, nie sind die Vertreter der Bundesratsparteien vor der EKR aufgetreten. Und schliesslich standen und stehen die Minderheiten unter Denkmalschutz: Kritische, faktenbasierte Bemerkungen, beispielsweise zur hohen Ausländerkriminalität, waren und sind unerwünscht.
Beispiel Islamkritik
Einige Mühe hat die EKR mit der Unterscheidung zwischen der inakzeptablen Islamophobie und berechtigter Islamkritik. Die Befürworter der Burka-Initiative und die Kritiker des Kopftuchs – immerhin eine Mehrheit des Schweizervolkes – werden zumindest indirekt in die rechte und islamfeindliche Ecke gestellt. Kein Wort über all die Verbrechen und Diskriminierungen, die unter Berufung auf den Koran verübt werden, von der Unterdrückung der Frauen bis hin zur Verfolgung von Andersgläubigen. Die SVP hat man für ihre vielleicht grenzwertige Wahlkampagne gegen «zu viele und die falschen Ausländer» kritisiert, aber zum zunehmenden muslimischen Antisemitismus in der Schweiz im Rahmen des gegenwärtigen Nahostkonflikts übt sich die EKR bis jetzt in vornehmer Zurückhaltung. Und was sagt die EKR zu Iran und zu den Hamas, die Israel von der Landkarte tilgen und die Juden vernichten wollen (das hatten wir doch schon einmal!)? Nichts.
Schon heute zu viele Vorschriften
Um mit einer positiven Note abzuschliessen: Das Sekretariat leistet professionelle Arbeit, das Budget ist mit jährlich weniger als 200 000 Franken sicher nicht überrissen, und die EKR ist eine wichtige Plattform für die Minderheiten – und ein nützliches Ventil, um Dampf abzulassen.
«Etwas mehr Gelassenheit und eine höhere Gewichtung der verfassungsrechtlich garantierten Meinungsäusserungsfreiheit würde der EKR gut anstehen.»
Rassismus und Diskriminierung liegen nicht im Interesse der Wirtschaft, sie schaden ihrem Ruf als attraktive Arbeitgeber. Neue zwingende Vorschriften und Quoten zur Besetzung von Arbeitsstellen zugunsten von Minderheiten sind dennoch strikte abzulehnen, die Wirtschaft und vor allem die KMU leiden schon heute unter zu vielen Vorschriften.
Fazit: Die EKR gehört nicht abgeschafft, Reformen im obgenannten Sinne sind aber unerlässlich, damit sie auch von den bürgerlichen Kreisen und der Wirtschaft ernst genommen und respektiert wird. Etwas mehr Gelassenheit und eine höhere Gewichtung der verfassungsrechtlich garantierten Meinungsäusserungsfreiheit würde der EKR gut anstehen. Nicht alles, was dumm und geschmacklos ist, gehört vor den Richter.
Ruedi Horber
Medienmitteilungen
Juso-Initiative ist ein Angriff auf Schweizer Traditionsunternehmen
Nationalrat stärkt die Sozialpartnerschaft
EU-Dossier: sgv startet breit abgestützten Vernehmlassungsprozess
AHV-Finanzierung: Unverantwortliche Abwälzung der Kosten auf Erwerbstätige und Junge
Kriegsmaterialgesetz: Das Ausland dürfte Vertrauen zurückgewinnen