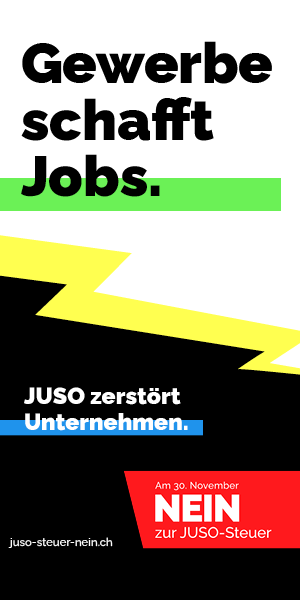Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates (WBK‑N) hat kürzlich ihre Position zu einem indirekten Gegenvorschlag zur sogenannten Kita-Initiative festgelegt. In Anlehnung an die Arbeiten der entsprechenden Kommission des Ständerates soll mit diesem Entwurf eine Betreuungszulage für Kinder nach dem Vorbild der Familienzulagen eingeführt werden. Hinter dem erklärten Willen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, wirft dieses Vorhaben erhebliche Probleme auf.
Erstens ist die familienergänzende Kinderbetreuung Sache der Kantone und Gemeinden. Es handelt sich hierbei nicht um eine Bundeskompetenz. Viele Kantone haben de facto bereits wirksame und an die lokalen Gegebenheiten angepasste Lösungen eingeführt. Diese Systeme, die häufig unter Beteiligung der Arbeitgeber entwickelt wurden, ermöglichen eine Antwort auf die spezifischen Bedürfnisse im Bereich der ausserschulischen Betreuung. Eine einheitliche Lösung auf Bundesebene, die durch eine nationale Umverteilung finanziert werden soll, würde die bereits unternommenen Anstrengungen ignorieren.
Inakzeptable Verlagerung der Verantwortung
Das zweite grosse Problem ist die Finanzierung dieser neuen Zulage. Der Entwurf sieht vor, dass die Arbeitgeber diese Leistung finanzieren, wie es bereits bei den Kinderzulagen der Fall ist. Diese Verlagerung der Verantwortung ist inakzeptabel. Sie würde eine zusätzliche jährliche Belastung von fast 640 Millionen Franken – oder je nach Entwicklung sogar noch mehr – bedeuten, die zu einem bereits schweren Paket von Arbeitgeberbeiträgen hinzukäme. Es sei daran erinnert, dass die Schweizer Unternehmen jedes Jahr die Familienzulagen mit mehr als 6,7 Milliarden Franken finanzieren. Eine solche Ausweitung der Sozialabgaben würde die Arbeitskosten, insbesondere für KMU, weiter erhöhen. Dies in einem wirtschaftlichen Umfeld, in dem die Wettbewerbsfähigkeit bereits stark unter Druck steht.
Kommt hinzu, dass der wenig zielgenaue Charakter der Leistung ein sehr grosses Problem darstellt. Die Leistung würde mit der Giesskanne ausbezahlt, ohne Rücksicht auf das Einkommen oder den Grad der Erwerbstätigkeit der Empfänger. Sie würde somit wohlhabenden Haushalten ebenso zugutekommen wie auch denjenigen, die sie wirklich benötigen. Schlimmer noch: Sie könnte von Eltern bezogen werden, die während der Betreuungszeiten nicht arbeiten, sondern ihre Freizeit geniessen. Mit dem Geld würden also Frei- oder Ruhezeiten subventioniert, die in keinerlei Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit stehen.
«Der erklärte Wille, die Präsenz von Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen, dürfte ins Leere laufen.»
Das läuft auch einem der angestrebten Ziele der Vorlage zuwider: die Beteiligung am Arbeitsmarkt zu erhöhen. Mehrere neuere Studien zeigen, dass Subventionen, die nicht an die Ausübung einer Tätigkeit geknüpft sind, kaum Auswirkungen auf die Entscheidung der Eltern haben, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Der erklärte Wille, die Präsenz von Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen, dürfte somit ins Leere laufen – dies bei sehr hohen Kosten.
Grosser bürokratischer Aufwand
Zudem würde die Vorlage zu einem grossen bürokratischen Aufwand führen: monatliche Überwachung der Betreuungstage, Überprüfung der zugelassenen Einrichtungen, Datenaustausch zwischen Arbeitgebern, Ausgleichskassen und Anbietern. Das brächte hohe indirekte Kosten mit sich – ohne Nutzen für die betroffenen Familien.
Es würde eine neue, ineffiziente bürokratische Struktur geschaffen, welche weit weg von den Realitäten vor Ort operiert. Und das alles, obwohl mehrere Kantone bereits Systeme zur direkten Subventionierung der Eltern eingeführt haben, die einfacher, zielgerichteter und rücksichtsvoller gegenüber den unterschiedlichen lokalen Gegebenheiten sind.
An vielen Fronten gefordert
Die Unternehmen sind bereits an vielen Fronten gefordert, insbesondere bei der Sanierung der Sozialversicherungen, allen voran der AHV. In einem solchen Kontext wäre es ein schwerer Fehler, die Belastung der Löhne noch weiter zu erhöhen. Es ist eine gefährliche Illusion zu glauben, dass man das Wachstum fördern, den Arbeitskräftemangel beheben und die Sozialsysteme reformieren kann, indem man die Unternehmen mit neuen Abgaben belastet.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser Gegenentwurf zur Kita-Initiative auf allen Ebenen problematisch ist. Er verstösst gegen die Grundsätze des Föderalismus, indem er in die kantonalen Kompetenzen eingreift. Er bürdet den bereits jetzt stark belasteten Unternehmen eine weitere einseitige finanzielle Belastung auf. Er beruht auf einer ineffizienten Verteilungslogik mit wenig Zielgenauigkeit und zweifelhaften wirtschaftlichen Auswirkungen. Und er führt eine unverhältnismässige bürokratische Komplexität ein, anstatt das Leben der Familien zu vereinfachen.
Wenn der Bund allgemeine Ziele wie die Entwicklung von Kindern oder die Verbesserung der Qualität von Betreuungseinrichtungen verfolgen will, muss er diese selbst finanzieren, indem er klare Prioritäten in seinem Haushalt setzt, und nicht, indem er die Unternehmen einmal mehr in die Rolle der Lückenbüsser für ein schlecht durchdachtes Projekt zwingt.
Simon Schnyder, Ressortleiter sgv