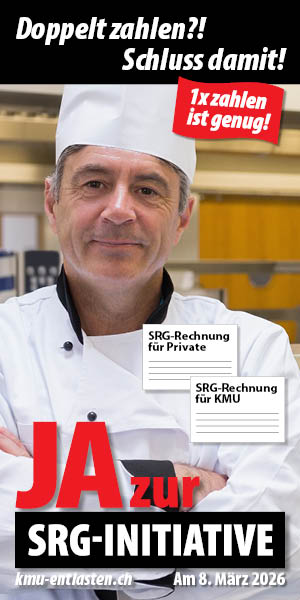Ein Zoll von 31 Prozent: Nicht nur die Schweiz rieb sich ungläubig die Augen ob der – nennen wir es – kreativen Berechnung des US-Präsidenten. Zwar wurde der Zoll temporär ausgesetzt, vom Tisch ist er nicht. Bereits Realität sind Zölle von zehn Prozent auf Exporte der Schweiz in die USA, die Folgen davon werden bald auch wirtschaftlich zu spüren sein. Bildete man sich in Bern einst ein, gute, ja sogar präferierte Beziehungen zu den USA zu haben, beginnt man zu realisieren, dass dies nicht für die Trump-Administration gilt.
Immer intensiver erschallt deshalb der Ruf, sich China zuzuwenden. Denn nach der EU und den USA zählen die Handelsbeziehungen zu China zu den drei wichtigsten unseres Landes. In den letzten Jahren gingen rund sechs Prozent aller Exporte aus der Schweiz nach China, insbesondere Pharmaprodukte, Maschinen, Uhren und Präzisionsinstrumente. Seit 1988 haben sie sich um den Faktor 27 erhöht. Ein sagenhafter Anstieg, auch im Vergleich zu den weltweiten Exporten der Schweiz, die sich immerhin vervierfachten (vgl. Grafik). Umgekehrt lieferte China eine breite Palette an Gütern in die Schweiz, von Elektronik über Textilien bis hin zu chemischen Produkten. Insgesamt bezog die Schweiz knapp sieben Prozent aller Importe aus dem Reich der Mitte.
Unsinniges Bürokratiemonster
Ein zentraler Pfeiler der Beziehungen ist das Freihandelsabkommen, das seit Mitte 2014 als erstes seiner Art zwischen einem kontinentalen europäischen Staat und China in Kraft ist. Es reduziert Zölle auf zahlreiche Produkte und erleichtert den Marktzugang, insbesondere für KMU. Seither haben sich nicht nur die Handelsvolumina vervielfacht, auch die Investitionen chinesischer Unternehmen in der Schweiz – insbesondere im Technologiebereich – haben zugenommen.
Doch dieser erfolgreiche wirtschaftliche Austausch steht unter kritischer Beobachtung. So wecken die Investitionen Chinas – auch wenn sie nur knapp zwei Prozent des Bestands aller ausländischer Direktinvestitionen in der Schweiz ausmachen – den politischen Argwohn. Mit dem Investitionsprüfgesetz (IPG) versucht eine Mehrheit des Parlaments dagegenzuhalten. Noch befindet sich das unsinnige Bürokratiemonster in der Beratung, der Schweizerische Gewerbeverband sgv wird weiter dagegen ankämpfen. Denn die Auswirkungen des IPG dürften auch für viele KMU empfindlich sein.
Ausgewogenes Verhältnis
Zusätzlich fordern viele Politiker und zivilgesellschaftliche Organisationen, dass bei Handelsabkommen auch soziale und ökologische Standards berücksichtigt werden müssen. Die Diskussion um eine «wertebasierte Aussenwirtschaftspolitik» hat in der Schweiz an Bedeutung gewonnen. Dies steht im Spannungsverhältnis zur geplanten Erweiterung des Freihandelsabkommens zwischen der Schweiz und China. Der zuletzt mit dem Besuch von Bundesrat Cassis in Peking intensivierte Austausch mit China sollen die Verhandlungen beschleunigen. Ob es dabei auch gelingt, unbequeme Fragen zur Menschenrechtssituation, zur Nachhaltigkeit oder gar zu den geostrategischen Ambitionen Chinas anzusprechen, ist heute jedoch alles andere als gewiss. Hinzu kommen Klagen von Schweizer Firmen, die sich der Willkür der chinesischen Verwaltung ausgesetzt sehen. Es wird vereinzelt von einer bewussten Benachteiligung ausländischer Unternehmen gesprochen, zum Beispiel bei öffentlichen Ausschreibungen oder der juristischen Durchsetzung des Urheberrechts.
Insgesamt zeigt sich: Die Beziehungen zwischen der Schweiz und China sind vielschichtig, dynamisch – und nicht ohne Spannungen. Die Kunst der Zukunft wird darin bestehen, wirtschaftliche Interessen und die geforderte «wertebasierte Aussenwirtschaftspolitik» in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. Es ist bereits heute abzusehen, dass der Souverän entscheiden wird, ob dies bei einem aktualisierten Freihandelsabkommen gelungen sein wird oder nicht.
dp