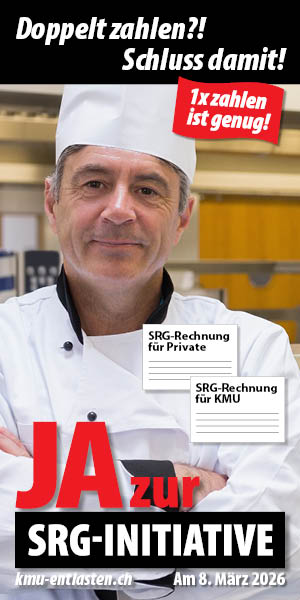Schweizerische Gewerbezeitung: Am 28. September stimmen wir über die Abschaffung des Eigenmietwertes ab. Sie haben den Eigenmietwert auch schon als «Geistersteuer» bezeichnet. Wie kommen Sie auf diesen Begriff?
Gregor Rutz: Mit dem Eigenmietwert wird ein Einkommen besteuert, das ein Haus- oder Wohnungseigentümer theoretisch erzielen könnte, wenn er sein Haus oder seine Wohnung vermieten würde. Dies will die betreffende Person aber nicht machen, weil sie ja dort wohnt. Entsprechend ist dieses Einkommen rein theoretischer Natur. Es wird also etwas besteuert, das es nicht gibt – darum ist der Begriff «Geistersteuer» absolut treffend.
Blenden wir kurz zurück: Wie ist diese doch sehr seltsame Steuer überhaupt entstanden?
Diese Steuer wurde 1933 per Notrecht als Abgabe zur Gesundung der Bundesfinanzen eingeführt. Es handelte sich um eine Kriegssteuer: In den Dreissigerjahren steckte die Schweiz aufgrund der Weltwirtschaftskrise und des sich abzeichnenden Kriegs finanziell in der Klemme. Der Eigenmietwert wurde erst 1958 ins ordentliche Recht überführt. Seither wird die Steuer mit einer völlig anderen Begründung erhoben.
Die Schweiz hat schon mehrmals über den Eigenmietwert abgestimmt; jedes Mal gab es ein Nein. Was ist bei der anstehenden Abstimmungsvorlage anders?
Die heutige Vorlage ist schlank und klar: Der Eigenmietwert wird abgeschafft, umgekehrt können auch keine Abzüge mehr geltend gemacht werden. Der Situation der Kantone wird Rechnung getragen über die neue Kompetenz für eine Objektsteuer. Zudem soll mit dem Ersterwerberabzug jungen Familien der Erwerb von Wohneigentum erleichtert werden. Man hat bei dieser Vorlage also wirklich an alles gedacht.
Die genannten Bestimmungen gelten aber nur für selbstbewohntes Wohneigentum. Für vermietete und verpachtete Liegenschaften ändert nichts – dort können Unterhaltskosten weiterhin abgezogen werden.
Gegner der Vorlage behaupten, Hauseigentümer liessen bei einem Ja zur Abschaffung des Eigenmietwerts ihre Liegenschaften verlottern. Was sagen Sie zu diesen Befürchtungen?
Das ist Unsinn. Es wird ja eine Steuer gestrichen. Dieses Geld verbleibt künftig bei den Eigentümern, die es direkt in den Unterhalt und die Sanierungen investieren können. Dies hat auch der Gewerbeverband erkannt – daher die klare Ja-Parole. Das Gewerbe wird mittelfristig sicher nicht weniger Aufträge haben, da bin ich sicher.
Die Gegnerschaft glaubt auch, dass der Mittelstand mehr Steuern bezahlen müsste, würde der Eigenmietwert abgeschafft. Interessanterweise sind darunter auch viele Linke, die sonst keinerlei Probleme mit höheren Steuern haben. Würde der Mittelstand tatsächlich stärker zur Kasse gebeten?
Auch das stimmt nicht. Steuersenkungen führen mittelfristig immer zu Mehrerträgen für den Fiskus. Die Logik ist einfach: Wer mehr Geld hat, gibt mehr aus. Dies gibt der Wirtschaft wichtige Impulse, mehr Umsatz und führt so zu zusätzlichen Steuererträgen.
«Es wird etwas besteuert, das es nicht gibt – darum ist der Begriff ‹Geistersteuer› absolut treffend.»
Ich hoffe, dass sich die linken Parteien auch künftig gegen Steuererhöhungen für den Mittelstand wehren, wenn dann wirklich solche anstehen.
Die Grünliberalen mochten sich, entgegen dem Vorschlag ihres Parteivorstandes, nicht zu einem Ja durchringen. Martin Bäumle jedoch, eines ihrer Aushängeschilder, nennt den Eigenmietwert «eine falsche Steuer» und ist klar für dessen Abschaffung. «Eine solche Chance kommt nicht so schnell wieder», glaubt Bäumle. Sehen Sie das auch so?
Ich freue mich, dass sich auch Martin Bäumle tatkräftig für die Abschaffung des Eigenmietwerts einsetzt. Die Grünliberalen haben in den Kantonen Zürich und Graubünden die Ja-Parole und auf schweizerischer Ebene eine Stimmfreigabe beschlossen. Neben dem Argument, dass diese Steuer falsch ist, war für die GLP auch wichtig, dass Abzüge im energetischen Bereich auf kantonaler Ebene möglich bleiben.
Nun kommt der Begriff «Eigenmietwert» auf dem Stimmzettel für den 28. September aber gar nicht vor. Ein Fehler?
Das Gesetz über den Systemwechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung beinhaltet die Streichung des Eigenmietwerts. Mit diesem Gesetz wurde eine zweite Vorlage verbunden: der Bundesbeschluss über die Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften. Gegen das Bundesgesetz ist kein Referendum ergriffen worden. Daher stimmen wir nur über den Bundesbeschluss ab, der den Kantonen die Möglichkeit für eine Objektsteuer eröffnet. Daher kommt der Begriff Eigenmietwert tatsächlich nicht vor – das ist richtig.
Wer würde von der Abschaffung des Eigenmietwerts profitieren, und wer nicht?
Von der Abschaffung des Eigenmietwerts profitieren alle. Die Hauseigentümer, weil eine ungerechte Geistersteuer gestrichen wird. Ältere Leute, weil der Eigenmietwert für sie eine besondere Belastung ist. Mieter und Junge, weil der Zugang zu Wohneigentum erleichtert wird. Die Vorlage bringt zudem begrüssenswerte volkswirtschaftliche Effekte, weil sie die Anreize zur Verschuldung senkt. Diejenigen, welche sparsam leben, werden künftig nicht mehr bestraft.
Was kommt auf die Hauseigentümer zu, sollte die Vorlage bachab gehen?
Wird der Eigenmietwert nicht abgeschafft, kommt es zu Steuererhöhungen. Der Eigenmietwert wird in den kommenden Jahren in allen Kantonen deutlich ansteigen – im Durchschnitt um über 30 Prozent! Im Kanton Zürich wissen wir bereits, dass Erhöhungen um elf Prozent drohen. In gewissen Kantonen wird die Erhöhung noch viel drastischer ausfallen – vor allem auch in den Westschweizer Kantonen. Das wurde dort noch nicht realisiert, was auch der Grund dafür ist, dass die Streichung des Eigenmietwerts in der Suisse Romande weniger Unterstützung findet.
Im Kanton Zürich ist die Situation anders: Dort sind die neuen Berechnungsgrundlagen derzeit Teil einer gerichtlichen Auseinandersetzung. Dass Leute, die sich in den Achtzigerjahren ein Häuschen gekauft haben, nun plötzlich mit einer Verdoppelung der Steuern rechnen müssen, nur weil sie im Umkreis von Zürich wohnen und dort die Preise besonders stark angestiegen sind, ist unglaublich. All diese Probleme können wir lösen, wenn die ungerechte Eigenmietwert-Steuer gestrichen wird.
Interview: Gerhard Enggist
www.faire-steuern.ch