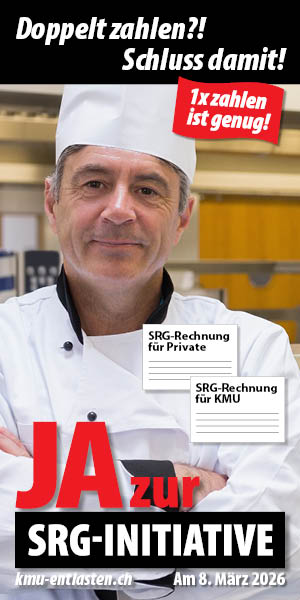Mit neun zu null Stimmen bei drei Enthaltungen hat die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerates (WBK-S) kürzlich die Vorlage zur Stärkung der höheren Berufsbildung angenommen. Das ist eine gute Ausgangslage für die Beratung des Geschäfts in der bevorstehenden Herbstsession, die am 8. September 2025 beginnt.
Die Gesetzesrevision sieht mehrere Neuerungen vor: die Einführung eines Bezeichnungsrechts für die höheren Fachschulen; die Einführung der Titelzusätze «Professional Bachelor» und «Professional Master» für die Abschlüsse der höheren Berufsbildung; die Einführung von Englisch als zusätzliche mögliche Prüfungssprache bei eidgenössischen Berufsprüfungen und höheren Fachprüfungen sowie eine Flexibilisierung des Nachdiplomstudienangebots der höheren Fachschulen.
sgv befürwortet Antrag des Bundesrats
Der Schweizerische Gewerbeverband sgv begrüsst die vorgeschlagene Einführung der Titelzusätze «Professional Bachelor» für Berufsprüfungen und für eidgenössisch anerkannte Bildungsgänge an höheren Fachschulen und «Professional Master» für höhere Fachprüfungen. Die zunehmende Tertiarisierung in der höheren Berufsbildung entspricht einem realen Bedürfnis der Wirtschaft, was sich unter anderem in der Lohnentwicklung der Absolventinnen und Absolventen widerspiegelt. Es ist wichtig, dass sich auch künftig Jugendliche und Absolventinnen und Absolventen einer Berufslehre bewusst für die Abschlüsse der höheren Berufsbildung entscheiden.
Mit der Einführung der Titelzusätze wird die Bedeutung der höheren Berufsbildung im In- und Ausland hervorgehoben. Eltern, Lehrpersonen und Berufsberaterinnen und Berufsberatern, die auf die Berufswahl Einfluss nehmen, wird verdeutlicht, dass die Berufsbildung gleichwertige Chancen zu den Hochschulabschlüssen bietet, die von der Wirtschaft auch nachgefragt und getragen werden.
«Die Förderung der höheren Berufsbildung macht aus wirtschaftlichen Gründen für die Betroffenen Sinn.»
Gerade gegenüber den non-formalen Weiterbildungsangeboten CAS, DAS und MAS ist dies wesentlich. Die «Weiterbildungs-Master» geniessen trotz ihrer Positionierung als non-formale Abschlüsse aufgrund ihrer englischen Bezeichnungen mittlerweile eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz. Um der heterogenen Branchenrealität gerecht zu werden, ist es den Organisationen der Arbeitswelt wichtig, dass die Titelzusätze ergänzend zu den im Arbeitsmarkt anerkannten landessprachlichen Titeln verwendet werden und die Differenzierung der drei Abschlüsse über die landessprachlichen Titel und zusätzlich über die Stufe des Nationalen Qualifikationsrahmens NQR weiterhin erfolgen kann.
Die Vorlage des Bundesrats ermöglicht weiterhin eine Differenzierung zwischen der Berufs- und höheren Fachprüfungen und den Abschlüssen der höheren Fachschulen durch den landessprachlichen Titel und dem NQR-Niveau. Im Übrigen steht es der Wirtschaft frei, Stellenausschreibungen ohne diese Titelzusätze zu tätigen oder den Titelzusatz beim Ausbildungsstand der Mitarbeitenden gegen aussen nicht sichtbar zu machen.
Höhere Bildungsrenditen mit HF-Abschluss
Studierende mit einem Abschluss an einer Höheren Fachschule HF fahren finanziell gesehen besser als mit einem Fachhochschulabschluss. Zu diesem Schluss kommt die Ende Juni 2025 publizierte Studie «Schlussbericht Bildungsrenditen an den Höheren Fachschulen». Die Förderung der höheren Berufsbildung macht damit auch aus wirtschaftlichen Gründen für die Betroffenen Sinn. Zu mehr Sichtbarkeit und ein höheres gesellschaftliches Ansehen kommen finanziell attraktive Perspektiven.
Mehr Abschlüsse auf Tertiärstufe
In den vergangenen Jahren hat die Zahl der Abschlüsse auf Tertiärstufe zugenommen, wobei die Hochschulabschlüsse stärker zugenommen haben als die Abschlüsse der höheren Berufsbildung. Diese Entwicklung birgt das Risiko, dass immer mehr Weiterbildungswillige an Fachhochschulen abwandern und den Unternehmen zunehmend berufspraktisch ausgebildete Fachkräfte fehlen.
Unternehmen benötigen laufend Fach- und Führungskräfte. Unter anderem auch deshalb, weil jedes Jahr Tausende von Unternehmen vor einem Generationen- beziehungsweise einem Leitungswechsel stehen.
Dieter Kläy, Ressortleiter sgv