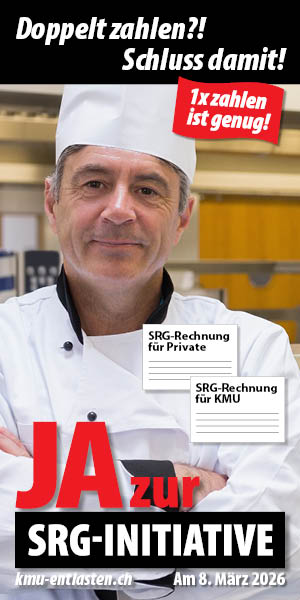«Der Bund erwartet von Unternehmen, dass ...»: Wie häufig ich diesem Satz schon begegnet bin, habe ich nicht gezählt. Aber es waren viele Male. Meistens taucht der Satz im Zusammenhang mit dem sog. Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) auf. Darin werden Erwartungen des Bundesrats an Berichterstattung und menschenrechtliche Sorgfalt von Unternehmen formuliert. Als ich den Satz in einer Präsentation einer hochrangigen Bundesbeamtin kürzlich wieder einmal sah, hat es mich «verjagt». Den erschrockenen Sitzungsteilnehmern erklärte ich, dass weder der NAP noch die Erwartungshaltung des Bundes auf einer gesetzlichen Grundlage basieren und dass es überhaupt wichtiger wäre, über die Erwartungen der Unternehmen an den Bund zu reden.
Auch das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV hat Erwartungen an die Unternehmen, beispielsweise an den Salzgehalt im Brot, das unsere Bäcker backen, oder an unsere Getränkehersteller betreffend den Zuckergehalt in ihren Produkten. Je fader das Brot und geschmackloser das Getränk, desto glücklicher ist die Verwaltung. Erst kürzlich hat das BLV mit vielen Unternehmen medienwirksam die sogenannte Erklärung von Mailand erweitert. Darin verpflichten sich die Unternehmen «freiwillig» zur Reduktion des Zuckergehalts in Produkten wie Quark, Frühstückscerealien oder Milchmischgetränken. Die Drohung dahinter: Werden die Ziele nicht erreicht, wird reguliert.
Seit längerem droht das BLV auch mit gesetzlichen Verboten bei der Bewerbung von Lebensmitteln für Kinder und Jugendliche. Nachdem sich eine breite Allianz gegen ein solches Verbot abzeichnet, treibt das Amt die Unternehmen nun mit «Erwartungen» an eine Selbstregulierung vor sich her. Diese sind so hoch, dass man sich in der Branche überlegt, ob es nicht besser wäre, den Hosenlupf im Parlament zu wagen.
Druck auf die Unternehmen macht der Bund auch über die Wettbewerbskommission. Diese verteidigt in der laufenden Revision des Kartellgesetzes mit aller Kraft ihre Praxis der sogenannten «Per-se-Erheblichkeit» von Abreden unter Unternehmen. Damit kann es sich die Behörde ersparen, die schädlichen Auswirkungen von Abreden nachzuweisen, indem es bestimmte Absprachen von vornherein («per se») als erheblich wettbewerbsbeschränkend erklärt. So können leichter Millionenbussen verteilt und Unternehmen mit einvernehmlichen Vereinbarungen in die Knie gezwungen werden. Die dabei eingesetzten Instrumente wie beispielsweise Hausdurchsuchungen sind auch medial wirkungsvoll. Deren Folgen für die eigene Reputation setzen auch Unschuldige unter Druck.
«Und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt» heisst es in Goethes «Erlkönig». Erlkönige gibt es in der Bundesverwaltung zuhauf. Wer die Erwartungen der Beamten erfüllt, dem wird Wohlwollen in Aussicht gestellt. Wer hingegen nicht spurt, dem drohen neue Gesetze, Verbote und Bussen.
Unternehmertum leben, bedeutet den Mut haben, Risiken einzugehen. Die geschilderten Fälle fördern aber risikominimierendes Verhalten. Dies befeuert die Compliance-Bürokratie und unterminiert letztlich einen Pfeiler des Unternehmertums. Deshalb bekämpft der Schweizerische Gewerbeverband konsequent unnötige Berichterstattungspflichten, Zuckerreduktionsstrategien, Werbeverbote und die überbordende Praxis der Wettbewerbskommission in der laufenden Kartellgesetzrevision.