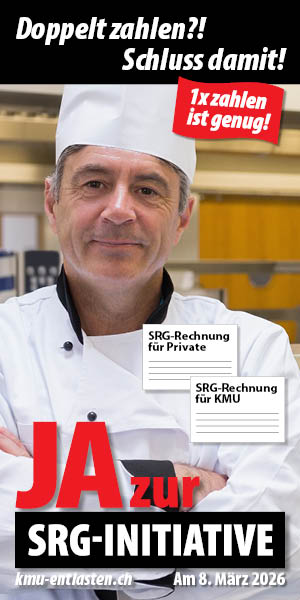Die Familienpolitik steht erneut im Mittelpunkt der politischen Debatten in Bern. Im Parlament zielen mehrere aktuelle Vorlagen darauf ab, die finanzielle Beteiligung des Bundes an der familienergänzenden Kinderbetreuung zu verlängern und auszuweiten sowie die Höhe der Familienzulagen zu erhöhen. Diese Vorlagen werden als Massnahmen zugunsten der Familien, der Gleichstellung und sogar als Lösungen für den Arbeitskräftemangel präsentiert. Sie würden jedoch dazu führen, dass die Rolle des Bundes in einem Bereich, der traditionell in die Zuständigkeit der Kantone und Gemeinden fällt, weiter verankert würde.
Auf den ersten Blick mag das verlockend erscheinen: einheitliche Regeln, landesweit gleiche Unterstützung, finanzielle Hilfe für Familien. Aber hinter dieser Fassade sind die Folgen klar: mehr Bürokratie, höhere Kosten, weniger Flexibilität, geringe Effizienz. Studien zeigen: Die Auswirkungen auf die Erwerbsbeteiligung sind oft begrenzt, während der Verwaltungsapparat immer grösser wird. Letztendlich sind es die Steuerzahler und KMU, die die Last tragen, durch höhere Steuern und Beiträge sowie zusätzliche bürokratische Auflagen.
Achtung für den Föderalismus
Jeder von Bern ausgegebene Franken ist mit Auflagen, Berichtspflichten und statistischen Erhebungen verbunden. Die mit diesen Finanzierungen einhergehenden Programmvereinbarungen erfordern ganze zusätzliche Verwaltungsebenen. Die Kantone verlieren ihre Fähigkeit, schnell zu handeln und Lösungen zu finden, die ihren Gegebenheiten entsprechen. Für die Unternehmen bedeutet dies indirekt strenge Vorschriften und zusätzliche Kosten.
Der Föderalismus ist jedoch einer der grössten Vorteile der Schweiz. Er ermöglicht es den Kantonen und Gemeinden, als Versuchslabore zu fungieren, in denen je nach den lokalen Bedürfnissen unterschiedliche politische Massnahmen erprobt werden können. Die Realitäten einer Grossstadt haben nichts mit denen eines ländlichen Kantons oder einer Bergregion zu tun. Die Wohnkosten, die Familiengewohnheiten, die Verfügbarkeit von Infrastrukturen und die Art des Engagements der Arbeitgeber variieren erheblich. Genau diese Vielfalt ermöglicht es, multidimensionale und pragmatische Lösungen zu entwickeln.
Starre Regeln statt Flexibilität
Wenn man von Bern aus eine einheitliche Lösung vorschreibt, erstarrt das System. Flexibilität und Innovation werden durch starre Regeln ersetzt. So entsteht eine kostspielige und ineffiziente Scheingleichheit.Auch in der Frage der Finanzierung darf man sich nichts vormachen. Wenn der Bund «Hilfe» verspricht, sind es immer die Steuerzahler und Unternehmen, die dafür bezahlen – sei es durch Bundes- und Kantonssteuern oder durch höhere Sozialabgaben.
Eine wirksame Familienpolitik entsteht nicht in den Korridoren des Bundes, sondern vor Ort. Die Kantone und Gemeinden wissen am besten, welche Massnahmen funktionieren und wie sie finanziert werden müssen. Einige bevorzugen eine direkte Unterstützung der Familien, andere stärken die institutionelle Betreuung oder setzen auf Partnerschaften mit Arbeitgebern. Diese Vielfalt ist eine Stärke, die es zu bewahren gilt, denn sie ermöglicht es, ständig zu testen, zu lernen und zu verbessern.
Mehr Zentralisierung heisst auch mehr Kosten
Eine echte Unterstützung der Familien in der Schweiz erfordert keine zusätzlichen Vorschriften auf Bundesebene, sondern die Wahrung der kantonalen Vielfalt und der lokalen Handlungsfreiheit. Die Rolle des Bundes muss subsidiär bleiben: Er muss Rahmenbedingungen festlegen und den Erfahrungsaustausch erleichtern, aber den Kantonen und Gemeinden die Verantwortung für die Ausarbeitung geeigneter Lösungen überlassen. Denn hinter der Zentralisierung verbergen sich vor allem Bürokratie und höhere Kosten, zum Nachteil der Familien und vor allem der KMU, die sie finanzieren.
ssc