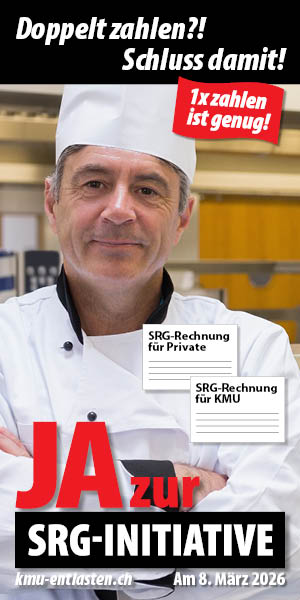Schweizerische Gewerbezeitung: Laut der vom Volk angenommenen Energiestrategie 2050 dürfen in der Schweiz keine neuen Kernkraftwerke (KKW) mehr gebaut werden. Nun aber unterstützt der Bundesrat im indirekten Gegenvorschlag zur «Blackout-Initative» eine Aufhebung des Neubauverbots. Hat Sie dieser Sinneswandel überrascht?
Annalisa Manera: Nicht wirklich. Die EU bezieht einen Viertel ihres Stroms aus den rund 100 in Betrieb befindlichen Kernkraftwerken. Mehrere EU-Länder planen neue Reaktoren, und einige, wie Polen, wollen mit der Nutzung von Kernenergie beginnen, um aus der Kohle auszusteigen. Auch Italien plant, wieder in die Kernenergie einzusteigen. Zwölf EU-Länder sind Teil der Europäischen Nuklearallianz, die im Jahr 2023 gegründet wurde mit dem Ziel, die Kernenergie in Europa zu fördern, Investitionen in neue und bestehende Reaktoren zu koordinieren und die technologische Entwicklung voranzutreiben.
Nur vier Länder hatten einen Ausstieg aus der Kernenergie geplant: Deutschland, Belgien, die Schweiz und Spanien. Belgien hat seinen Kurs geändert und erst im vergangenen Mai das Verbot neuer Kernkraftwerke aufgehoben. Spanien hat kürzlich beschlossen, die Laufzeit der bestehenden Kernkraftwerke aus Sorge um die Stromversorgungssicherheit zu verlängern.
Was bedeutet die neue Haltung des Bundes gegenüber der Kernkraft für die mittel- und langfristige Energieversorgung der Schweiz?
Bis 2050 wird unser Stromverbrauch um mindestens 25 TWh/Jahr steigen. Die Schweizer Kernkraftwerke produzieren 23 TWh/Jahr. Es ist klar, dass die Herausforderung ohne neue Kernkraftwerke doppelt so gross wird. Natürlich müssen wir weiterhin in erneuerbare Energien investieren, aber langfristig (über 20 Jahre) wäre es ratsam, die Op-tion neuer Kernkraftwerke für die Zeit nach der Abschaltung von Gösgen und Leibstadt offenzuhalten. Allein diese zwei KKW produzieren 17 TWh/Jahr.
Kritiker werfen nach wie vor ein, neue KKW wären nicht rentabel und könnten eh kaum vor 2050 in Betrieb gehen. Teilen Sie diese Ansicht?
Es gibt auch viele private Unternehmen, die in die Kernenergie investieren. Dies wäre nicht der Fall, wenn die Kernenergie nicht wirtschaftlich rentabel wäre. Man sollte sich die Grössenordnung vor Augen halten: Zwar ist ein grosses Kernkraftwerk teuer, aber es würde rund um die Uhr so viel Strom produzieren wie über 1300 Windturbinen und hat eine Lebensdauer von mindestens 60 Jahren. Sollte die Schweiz in 20 Jahren ein neues Kraftwerk bekommen, käme dies zum richtigen Zeitpunkt, wenn Gösgen und Leibstadt ersetzt werden müssen.
Zudem behaupten Kernkraftgegner, die Lagerung radioaktiver Abfälle sei nach wie vor ungelöst. Trifft dies zu? Immerhin hat sich die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) mit Nördlich Lägern für einen aus ihrer Sicht sicheren Standort für ein Tiefenlager entschieden.
Das Problem ist technisch gelöst, politisch bleibt es jedoch weiterhin offen. Finnland und Schweden bauen bereits State-of-the-Art-Tiefenlager, und Finnland steht kurz vor der Inbetriebnahme.
Dabei ist zu bedenken, dass aufgrund der sehr hohen Energiedichte des Kernbrennstoffs die Menge hochradioaktiver Abfälle sehr gering ist, insbesondere im Vergleich zu den sehr grossen Mengen hochgiftiger chemischer Abfälle. So beträgt beispielsweise der hochradioaktive Abfall, den alle Schweizer Kernkraftwerke in 60 Betriebsjahren produzieren würden, ein Volumen von 1300 Kubikmetern; das entspricht etwa dem Volumen von zwei Einfamilienhäusern.
Deutschland hat zwar noch keine Lösung für die Endlagerung radioaktiver Abfälle vorgeschlagen, verfügt jedoch über mehrere geologische State-of-the-Art-Tiefenlager für hochgiftige chemische Abfälle. Allein eines dieser Lager, Herfa-Neurode, hat bereits mehrere Millionen Kubikmeter dieser Abfälle gelagert, die im Gegensatz zu radioaktiven Abfällen nicht mit der Zeit zerfallen: In einer Million Jahren werden sie genauso giftig sein wie heute. Dies wird überhaupt nicht thematisiert und hinterlässt den Eindruck, dass nur die Kernenergie ein Abfallproblem hat.
In der öffentlichen Diskussion werden die positiven Aspekte der Kernenergie oft unterschlagen. Was sagen Sie dazu?
Dies würde eine lange Antwort erfordern. Ich gebe nur ein Beispiel: Aufgrund ihrer hohen Energiedichte weist die Kernenergie im Vergleich zu anderen Energiequellen einen der kleinsten ökologischen Fussabdrücke auf. So erfordert Kernenergie von allen Energiequellen mit Abstand den geringsten Abbau pro erzeugter KWh. Wussten Sie das?
Was wir wissen, ist: Auf dem Weg in eine CO2-arme Zukunft nimmt der Bedarf an elektrischer Energie stark zu. Können die «Erneuerbaren» – Wind- und Wasserkraft sowie die Solarenergie – den künftigen Bedarf decken?
Die neuste Studie der ETH Zürich, der EPFL und weiterer Schweizer Universitäten sagt ja, allerdings unter folgenden Bedingungen: höhere Importe im Winter, die eine gute Integration mit der EU erfordern, erhebliche Subventionen, um das erforderliche Ziel für erneuerbare Energien zu erreichen, beträchtliche Windproduktion (einige tausend grosse Windkraftanlagen), Gaskraftwerke als Backup sowie Importe synthetischer Kraftstoffe. Eine geringere Integration (weniger Importe) mit der EU würde zu höheren Stromkosten führen und Gas zu einem integralen Bestandteil des Strommixes machen.
Was bedeuten allfällige neue KKW für die Stromversorgung in unserem Land, für das Erreichen der Klimaziele – und nicht zuletzt für die Kosten der Energie?
Die Beibehaltung der Kernenergie im Schweizer Strommix wird das Erreichen der Klimaziele definitiv erleichtern. Bedenken Sie, dass es bisher keinem Land in Europa gelungen ist, sowohl die Kernenergie als auch die fossilen Brennstoffe in der Stromerzeugung abzuschaffen, mit Ausnahme von Norwegen (90 Prozent Wasserkraft) und Island (70 Porzent Wasserkraft, 30 Prozent Geothermie). Und Strom macht nur 30 Prozent der gesamten Energie aus, die wir zur Dekarbonisierung benötigen.
Bei den Kosten muss man das Gesamtsystem betrachten, also auch Speicher, Backup, Netzausbau. Die Einbeziehung der Kernenergie in den Strommix verringert den Bedarf an saisonaler Speicherung, Backup und Netzausbau. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass ein ausgewogener Strommix aus Kernenergie und erneuerbaren Energien zu insgesamt niedrigeren Kosten führen würde. Eine von der OECD veröffentlichte Studie über die zukünftige Energiesituation in der Schweiz zeigt, dass neue Kernkraftwerke im Schweizer Strommix sowohl zu niedrigeren Kosten als auch zu einer grösseren Unabhängigkeit von Europa beitragen würden. Derzeit gibt es leider nur sehr wenige Studien speziell für die Schweiz.
Mitte der 2010er-Jahre sank unter jungen Menschen die Begeisterung rapide, ein Studium für Strahlen- und Energietechnik aufzunehmen. Heute steigt die Anzahl Studierender wieder stark an. Was sagt dies aus über die Zukunft Ihres Fachbereichs – und die Zukunft der Kernenergie?
Nachwuchsförderung ist in jedem Bereich von entscheidender Bedeutung. Die Zahl der Studierenden in meinem Master-Einführungskurs in Kernenergie ist innerhalb von drei Jahren von 60 auf 150 gestiegen. Umwelt und Klimawandel sind für die neuen Generationen besonders wichtig. Aus diesem Grund sehen viele junge Menschen in der Kernenergie einen Teil der Lösung. In Finnland unterstützt sogar die nationale grüne Partei die Kernenergie. Dieser Positionswechsel begann bei den jungen Mitgliedern der Partei. Insgesamt erkenne ich eine grosse Begeisterung der jungen Generation für die Fortschritte der Kernenergie in den letzten Jahrzehnten. Es ist eine sehr spannende Zeit, heute in der Kernenergie zu arbeiten. Ich habe in meiner gesamten Karriere noch nie so viele private Investitionen und Startups im Bereich der Kernenergie gesehen.
Interview: Gerhard Enggist