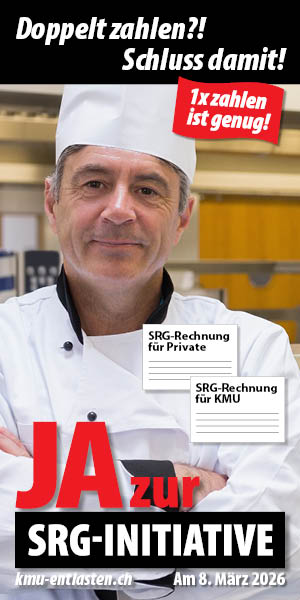Das Schreckensszenario, es ist immer noch nicht vom Tisch. Nämlich: die 13. AHV-Rente vollständig oder teilweise und zusätzlich auch noch die Aufhebung des AHV-Rentenplafonds bei Ehepaaren durch eine Erhöhung der Lohnbeiträge zu finanzieren. Auch wenn der Nationalrat diese Option vorerst verworfen hat, wurde sie vom Ständerat im Frühjahr klar befürwortet.
«Wenn sowohl Renten als auch Arbeitsplätze erhalten bleiben sollen, sind zusätzliche Lohnbeiträge keine Lösung.»
Es gibt also keine Garantie dafür, dass sie im endgültigen Kompromiss doch nicht wieder auftaucht. Für die Schweizer Wirtschaft und insbesondere für arbeitsintensive KMU hätte eine Erhöhung der Lohnbeiträge schwerwiegende, dauerhafte und weitgehend unterschätzte Folgen.
Gut gemeinte, aber schädliche Ideen
Die Befürworter einer solchen Beitragserhöhung verweisen oft auf deren scheinbare Schmerzlosigkeit. Ein paar Zehntel Prozentpunkte mehr Beitragssatz sind ihrer Meinung nach so minimal, dass sie Arbeitgeber und Arbeitnehmer kaum spüren. Dieses Argument verschleiert jedoch eine wesentliche Tatsache, dass sich jede Erhöhung der Arbeitskosten direkt auf Entscheidungen über Einstellungen, Investitionen und Ausbildung auswirkt. In handwerklichen KMU, in denen die Lohnsumme zwischen 50 und 60 Prozent der Gesamtkosten ausmacht, entspricht eine Erhöhung des Beitragssatzes um 0,5 Prozentpunkte einer Steigerung der Betriebskosten um 0,25 bis 0,3 Prozent. Bei Nettomargen von oft weniger als 3 Prozent reicht diese Veränderung manchmal aus, um den gesamten Jahresgewinn zunichtezumachen.
Hinzu kommt der kumulative Effekt. Im Bereich der Familien- und Sozialpolitik häufen sich Vorschläge gut gemeinter, aber letztlich schädlicher Ideen: Erhöhung des Kindergeldes, Verlängerung des Elternurlaubs, höhere Zuschüsse für Kinderbetreuungseinrichtungen oder neue Beihilfen. Jeder einzelne Vorschlag wird isoliert als Fortschritt dargestellt, der oft gesellschaftlich gerechtfertigt sei. Nur: Diese Anhäufung führt automatisch zu einem grossen Anstieg der Arbeitskosten. Für KMU wird diese permanente Dynamik zu einem strukturellen Risiko. Die Finanzierung der AHV und deren Leistungsausbau durch ein erneutes Anzapfen der Lohnsumme würde diese Spirale nur noch verstärken, indem sie die Belastungen in einem ohnehin schon angespannten wirtschaftlichen Umfeld weiter erhöht.
Spürbare Effekte
Zwar gibt es bislang keine Studie, die sich speziell mit den Auswirkungen einer Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge zur AHV auf die Beschäftigung in KMU in der Schweiz befasst. Doch Untersuchungen in vergleichbaren wirtschaftlichen Kontexten liefern nützliche Grössenordnungen. Internationale Studien zeigen, dass die Elastizität der Arbeitsnachfrage gegenüber den Arbeitskosten im Durchschnitt zwischen 0,25 und 0,35 liegt. Mit anderen Worten: Eine Erhöhung der Gesamtlohnkosten um ein Prozent führt mittelfristig zu einem Rückgang der Beschäftigung um 0,25 bis 0,35 Prozent. In Deutschland und Österreich kommen empirische Studien zu ähnlichen Werten, die je nach Branche und Unternehmensgrösse zwischen 0,2 und 0,35 liegen. Analog dazu kann man davon ausgehen, dass die Auswirkungen in arbeitsintensiven Branchen der Schweiz wie dem Handwerk, dem Baugewerbe oder der Gastronomie ähnlich sind.
Auf dem Papier scheint diese Art der Anpassung minimal zu sein, aber sie hat unmittelbare Auswirkungen auf Managemententscheidungen: Aufschub einer Investition, Einstellungsstopp oder Verzicht auf die Ausbildung eines Lehrlings. Wenn man dieses Verhalten mit mehreren Zehntausend vergleichbaren Unternehmen multipliziert, dann erhält man spürbare makroökonomische Effekte auf die Beschäftigung und die Wirtschaftsdynamik. In einem Wirtschaftsgefüge, das zu mehr als 99 Prozent aus KMU besteht, sind diese Auswirkungen nicht marginal, sondern kumulativ.
Selbst begrenzte Erhöhungen, die auf individueller Ebene als symbolisch empfunden werden, belasten letztendlich die Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen erheblich. Es geht also nicht um die von den Befürwortern gerne ins Spiel gebrachten berühmt-berüchtigten «ein paar Tassen Kaffee pro Monat», sondern um die Fähigkeit unserer Wirtschaft, Arbeitsplätze zu erhalten und in ihre Zukunft zu investieren.
Europäische Länder senken Sozialabgaben
Es sei auch daran erinnert, dass die Finanzierung der 13. Rente und des Gegenvorschlags zur Initiative der Mitte keine marginale Anpassung darstellt. Zusammen würden diese beiden Forderungen mittelfristig fast zehn Milliarden Franken pro Jahr kosten. Allein die Aufhebung der Obergrenze für Ehepaarrenten bei der AHV würde mehr als vier Milliarden Franken kosten. Selbst wenn nur ein Teil dieser Beträge durch Lohnbeiträge finanziert würde, das heisst – wie vorgesehen – durch eine zusätzliche Abgabe von 0,4 bis 0,6 Beitragspunkte, würde dies einen erheblichen Schock für die Lohnsumme bedeuten.
Die Versuchung, auf Lohnbeiträge zurückzugreifen, ist politisch zwar verständlich, da dadurch eine sichtbare Erhöhung der Mehrwertsteuer vermieden werden kann. Sie beruht jedoch auf einem wirtschaftlichen Missverständnis: Die Besteuerung von Arbeit kommt einer Besteuerung der nationalen Produktion und der Beschäftigung gleich, während die Mehrwertsteuer die Belastung gerechter verteilt, auch auf importierte Konsumgüter. Aus diesem Grund haben sich die meisten europäischen Länder in den letzten Jahren dafür entschieden, die Sozialabgaben schrittweise zu senken zugunsten von Steuern mit einer breiteren Bemessungsgrundlage, wie der Mehrwertsteuer oder der Umweltsteuer. Diese von der OECD und der Europäischen Kommission dokumentierte Entwicklung zielt darauf ab, die Arbeitskosten zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, ohne die Stabilität der öffentlichen Finanzen zu gefährden.
Vorhersehbare Sackgasse
Langfristig kann die Nachhaltigkeit der AHV jedoch nur durch eine strukturelle und möglichst kostenneutrale Reform gewährleistet werden. Auf wiederholte Lohnbeitragserhöhungen zu setzen hiesse, die Symptome statt die Ursache zu bekämpfen. Das Gleichgewicht der ersten Säule muss durch Anpassungen des Referenzalters, durch automatische Ausgleichsmechanismen und durch echte Anreize zur Verlängerung der Erwerbstätigkeit über das Rentenalter hinaus wiederhergestellt werden, nicht durch eine höhere Besteuerung der produktiven Arbeit.
Die Sozialpolitik muss mit dem wirtschaftlichen Wohlstand vereinbar bleiben. KMU fordern nicht weniger Solidarität, sondern mehr Kohärenz. Wenn sowohl Renten als auch Arbeitsplätze erhalten bleiben sollen, sind zusätzliche Lohnbeiträge keine Lösung: Sie sind eine vorhersehbare Sackgasse, deren Kosten sich diesmal nicht in «Tassen Kaffee» bemessen lassen, sondern in verlorenen Arbeitsplätzen und geschwächten Unternehmen.
Simon Schnyder, Ressortleiter sgv