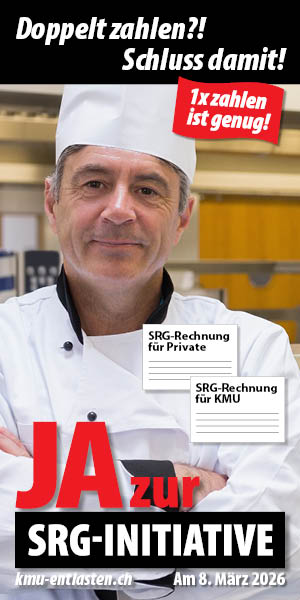Die Herbstsession 2025 hat zwar nicht alle Unsicherheiten rund um die AHV beseitigt, aber das Schlimmste für die Unternehmen abgewendet. Der Nationalrat hat sich dafür entschieden, die 13. Rente durch eine vorübergehende Erhöhung der Mehrwertsteuer und nicht durch eine Erhöhung der Lohnbeiträge zu finanzieren. Für die Unternehmen ist dies ein positives Signal. Eine Finanzierung eher über den Konsum als über die Arbeit stellt in der aktuellen Situation das kleinere Übel dar.
Das verabschiedete Modell sieht eine auf fünf Jahre befristete Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,7 Prozentpunkte vor, um die Kosten der 13. Rente zu decken, welche auf beinahe fünf Milliarden Franken pro Jahr geschätzt werden. Der Nationalrat lehnte damit das Szenario einer gemischten Finanzierung aus Mehrwertsteuer und Sozialabgaben ab, für das sich der Ständerat im Frühjahr ausgesprochen hatte. Er verzichtete auch darauf, den Beitrag des Bundes an die AHV zu kürzen, wie es der Bundesrat ursprünglich vorgeschlagen hatte. Die Debatte wird im Winter fortgesetzt. Aber vorerst ist der Nationalrat standhaft geblieben und hat keine zusätzlichen Belastungen für die Löhne beschlossen.
Zusatzkosten von einer Milliarde
Parallel dazu haben die Parlamentarier der grossen Kammer eine weitere Front eröffnet. Sie haben die Reform der Witwenrenten mit der Mitte-Initiative zur Aufhebung des Plafonds für Ehepaarrenten verknüpft. Konkret soll die Reform der Hinterlassenenrente als Teil eines Gegenvorschlags zur Initiative der Mitte dienen. Das verändert die Logik der ersten Säule grundlegend. Die neuen Ehepaarrenten in der AHV würden nicht mehr gedeckelt, während der jetzige Plafond von 150 Prozent für bestehende Ehepaarrenten beibehalten würde. Im Gegenzug soll der Witwen- und Witwer-zuschlag für neue Begünstigte abgeschafft werden, während er für Witwen und Witwer, die bereits eine Rente beziehen, beibehalten würde. Diese Änderungen zielen darauf ab, das System an die europäische Rechtsprechung anzupassen und die Leistungen zu modernisieren.
Die Kehrseite der Medaille ist jedoch schwerwiegend: Diese Reform würde mittelfristig zusätzliche Kosten von über einer Milliarde Franken verursachen. Mit anderen Worten: Gerade jetzt, wo die 13. Rente die Belastung der Altersversicherung erhöht hat, fügt das Parlament eine weitere Schippe an neuen Ausgaben hinzu, ohne dass eine entsprechende Finanzierung vorhanden ist. Diese Fehlentwicklung verdeutlicht einmal mehr die politische Versuchung, die Leistungen auszuweiten, bevor die finanzielle Basis stabilisiert ist.
Vom Flickwerk abrücken
Die Entscheidung des Nationalrats, die Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge vorerst zurückzustellen, ist zu begrüssen. Doch es ist weiterhin Vorsicht geboten. Der Druck auf die Finanzen der AHV wird sich mit der Alterung der Bevölkerung und dem Rückgang des Wachstums der Erwerbsbevölkerung weiter verstärken. Ohne Strukturreformen werden sich die Probleme nur noch verschärfen.
Es ist dringend notwendig, von der Logik des Flickwerks und der punktuellen Anpassungen abzurücken. Jede ernsthafte Reform muss kostenneutral und auf langfristige Stabilität ausgerichtet sein. Die AHV kann nur dann nachhaltig sein, wenn sie die demografische und wirtschaftliche Realität des Landes berücksichtigt. Reformen aufzuschieben und gleichzeitig die Leistungen auszuweiten, ist eine kurzsichtige Politik, deren Folgen die Eidgenössischen Räte früher oder später Rechnung tragen müssen.ssc