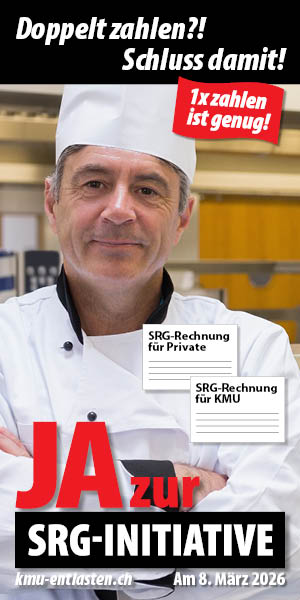In Schweizer Städten wird viel gebaut. Baumaschinen lärmen von früh bis spät, Abgase hängen in der Luft. Doch es gibt Alternativen: In Zürich, Luzern und Basel laufen dieses Jahr drei Pilotprojekte für sogenannte E-Baustellen. Bagger, Dumper und Lastwagen mit Elektroantrieb arbeiten leiser und ohne Abgase. Das verbessert Lebensqualität und Arbeitsbedingungen.
Und: Die Elektrifizierung hilft, Klimaziele zu erreichen. Heute verursachen Baumaschinen in der Schweiz jährlich Tausende Tonnen CO2. Eine Umstellung auf Elektroantriebe könnte diesen Anteil erheblich senken. Beispiele aus dem Ausland zeigen, dass es machbar ist. In Oslo waren 2023 bereits 98 Prozent der städtischen Baustellen fossilfrei, davon ein Viertel rein elektrisch. Schon dieses Jahr sollen alle öffentlichen Projekte emissionsfrei sein – dank Vorgaben.
Forschungsprojekt untersucht Schweizer Pilotbaustellen
Erfolge wie in Norwegen inspirierten ein neues Forschungsprojekt der Hochschule Luzern (HSLU). Es untersucht, wie E-Baustellen umgesetzt werden können, und bezieht die Städte Luzern, Basel und Zürich sowie Bauunternehmen, Hersteller und Vermieter von Baumaschinen ein. Erste Ergebnisse zeigen: In der Schweiz setzen Bauunternehmen bislang kaum elektrische Maschinen ein, obwohl fast alle Typen erhältlich sind.
Einzelne Betriebe berichten von positiven Erfahrungen mit Elektrolastwagen in der Logistik. Doch bei Baggern und Dumpern bleibt die Nachfrage gering. Hauptgrund sind die hohen Anschaffungspreise: Ein Elektrobagger kostet oft doppelt so viel wie ein Dieselmodell. Erst mit steigender Nachfrage und Produktion sinken die Preise.
Die Rolle der öffentlichen Hand
Hier könnte die öffentliche Hand entscheidend Einfluss nehmen. Städte und Gemeinden machen rund 40 Prozent des Bauvolumens in der Schweiz aus. Würden sie in Ausschreibungen den Einsatz elektrischer Maschinen fordern, wie in Oslo, könnte das die Nachfrage ankurbeln. Das HSLU-Projekt untersucht, wie solche Vorgaben in der Praxis realistisch gestaltet werden können.
Elektrifizierung betrifft nicht nur Maschinen, sondern auch Planung und Betrieb: Ausschreibung, Stromanschluss und Lademanagement müssen durchdacht werden. Für Bauunternehmen bedeutet das zusätzlichen Aufwand, zumindest am Anfang. Unterstützung erhalten die Pilotstädte von der ecoforce GmbH, die auf emissionsfreies Bauen spezialisiert ist.
Noch Ausnahme statt Regel
Interviews mit über zehn weiteren Schweizer Städten und Gemeinden zeigen: Ambitionen zur Elektrifizierung von Baustellen sind noch selten. Zürich, Luzern und Basel gehören zu den Vorreitern. Gerade deshalb sind Pilotprojekte wichtig – um Erfahrungen zu sammeln, Hindernisse sichtbar zu machen und Lösungen aufzuzeigen.
Die Elektrifizierung von Baustellen ist technisch möglich. Sie bringt Vorteile für Anwohner, Mitarbeitende und Umwelt und kann mit klaren Vorgaben der öffentlichen Hand zum Standard werden. Entscheidend ist, jetzt Erfahrungen zu sammeln und praktische Empfehlungen für Bauunternehmen, Städte und Gemeinden zu entwickeln. So entsteht aus der Herausforderung eine Chance: für leisere Städte, saubere Luft und eine zukunftssichere Bauwirtschaft.
Karina von dem Berge*
* Karina von dem Berge ist Dozentin und Pro-jektleiterin am Competence Center für Service und Operations Management an der Hochschule Luzern – Wirtschaft. Ihre Schwerpunkte in der Forschung liegen in der Entwicklung und der Steuerung von nachhaltigen Geschäftsökosystemen, B2B-Sharing und Kreislaufwirtschaft.