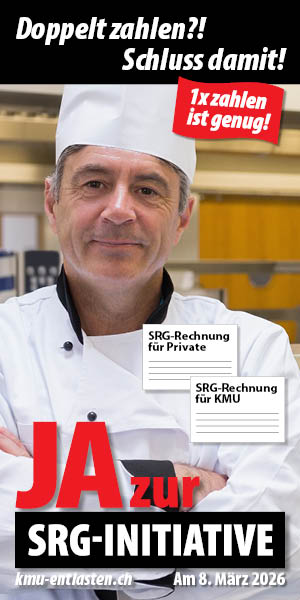Schweizerische Gewerbezeitung: Der sgv hat mit einer Umfrage bei den Kantonalen Gewerbeverbänden (KGV) den Puls der KMU gefühlt. Wie geht es den kleinen und mittleren Unternehmen der Schweiz im Hebst 2025?
Urs Furrer: Die KMU bewerten die wirtschaftliche Entwicklung in den letzten 12 Monaten mehrheitlich als «unverändert», mehr als ein Viertel bezeichnet das letzte Jahr sogar als «gut». Doch für die Zukunft sehen die KMU schwarz. Auf die Frage, wie sie die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten 12 Monaten im Vergleich zum letzten Jahr bewerten, antworten mehr als die Hälfte mit einem «schlechter». Besonders auffällig ist: Niemand schätzt die Lage so ein, dass sie «besser» geschweige denn «viel besser» wird.
Was sind die Gründe, weshalb das Gewerbe pessimistisch in die Zukunft blickt?
Die Herausforderungen sind derzeit sehr gross. Die Konjunktur trübt sich ein, die Wirtschaft in der EU stottert, in der Ukraine herrscht immer noch Krieg, und die massiven US-Zölle belasten insbesondere die Exportindustrie.
Und langfristige Herausforderungen werfen ihren Schatten voraus: Der Bundeshaushalt ist in Schieflage, es drohen Lohnkostenerhöhungen für die Sozialwerke, insbesondere die AHV.
«wir können das Paket, so wie es in die Vernehmlassung geschickt wurde, nicht unterstützen.»
Dann soll es zu alledem noch einen Elternurlaub, Gratis-Kitas usw. usf. geben – als ob es die Weltlage zulassen würde, sich heute bequem zurückzulehnen. Das Gegenteil ist der Fall: Wir sollten endlich aufwachen. Auch bei der Energiepolitik: Wir laufen in ein Riesenproblem, wenn wir die jetzigen Kernkraftwerke einst vom Netz nehmen müssen und keine neuen mehr zubauen können.
Welche Themen machen den KMU ganz konkret im Alltag zu schaffen?
Es ist insbesondere die Bürokratie, die – wie Unkraut – stets weiter wuchert, aber auch die Raumplanung sowie in vielen Branchen auch immer noch der Fachkräftemangel.
Stichwort Bürokratie: Sie nimmt aufgrund des Dauerbrenners «Regulierungskosten» stets zu. Wie gross ist das Problem effektiv?
Laut einer Hochrechnung des sgv verursachen Regulierungen durch Gesetze, Verordnungen etc. jährliche Kosten in Höhe von rund 10% des BIP – das sind rund 80 Milliarden Franken pro Jahr! Konzerne können mit ihren Compliance-Teams auch umfangreiche Regulierungen bewältigen. Für KMU ist dies in der Regel nicht möglich, weil der Aufwand im Verhältnis zur Grösse des Unternehmens eine unverhältnismässige Belastung darstellt. Es ist deshalb wichtig, in der herausfordernden wirtschaftlichen Situation die KMU zu stärken, statt sie weiter zu schwächen.
Welche Forderungen stellt der sgv in diesem Zusammenhang?
Wir fordern den Bundesrat mit einer Motion auf, zum Schutz der KMU eine Regulierungskostenbremse einzuführen – ähnlich der Schuldenbremse. Bundesgesetze und völkerrechtliche Verträge, die für KMU erhebliche zusätzliche Regulierungskosten verursachen, müssen erhöhte Anforderungen im Gesetzgebungsprozess erfüllen. Diese Anforderungen können durch ein qualifiziertes Mehr der beiden Räte oder dadurch erfüllt werden, dass bestehende Erlasse mindestens in gleichem Umfang aufgehoben oder geändert werden.
Die KMU-Regulierungskostenbremse soll greifen, wenn eine zu definierende Anzahl Schweizer KMU betroffen ist respektive wenn die erwarteten Mehrkosten für KMU über einer zu definierenden Kostenschwelle liegen.
Heute schätzen die jeweiligen Bundesämter die Regulierungskosten ihrer eigenen Erlasse gleich selbst. Der sgv fordert mit einer weiteren Motion nun eine unabhängige Kostenschätzung. Warum?
Weil viele Ämter und von ihnen beauftragte Agenturen gar kein Interesse haben, die Regulierungskosten exakt abzuschätzen, und diese kleinreden. Im Lebensmittelbereich zum Beispiel hat das zuständige Bundesamt jüngst eine Agentur beauftragt, die Regulierungskosten einer geplanten Werbebeschränkung zu erheben. Diese schrieb unter Ausblendung vieler wichtiger Faktoren – und damit falsch – einen angeblichen Nutzen von Werbebeschränkungen herbei. Eine Schätzung der Regulierungskosten fehlte jedoch gänzlich.
Hier zeigt sich das grundlegende Problem: Die für die Regulierung zuständigen Ämter haben meistens ein Interesse an einer neuen Regulierung, welche sie oft gleich selbst vorschlagen. Von ihnen beauftragte Beratungsfirmen haben ein Interesse am Erhalt von weiteren Aufträgen. Darum neigen sie zu Ergebnissen im Sinne der auftraggebenden Ämter.
Zur Beseitigung dieses Missstandes fordert der sgv, die Federführung der Regulierungskostenschätzung dem SECO zu übertragen. Es ist heute schon für die methodischen Grundlagen zuständig. So wird das Problem ohne Zusatzkosten gelöst.
In Bezug auf das Vertragspaket Schweiz–EU stellt der sgv ebenfalls mehrere Bedingungen, eine davon ist die bereits erwähnte Regulierungskostenbremse. Was sind weitere Forderungen?
Zuerst: Der sgv steht weiterhin zu den Bilateralen Verträgen. In einer Würdigung aller Vor- und Nachteile können wir das Paket mitsamt Umsetzungsvorschlägen, so wie es in die Vernehmlassung geschickt wurde, aber nicht unterstützen. Wir lassen die Tür für eine allfällige Zustimmung jedoch offen. Diese ist an klare Bedingungen geknüpft.
Wichtig ist, dass es eine spürbare Entlastung der KMU braucht und die demokratische Mitwirkung sichergestellt sein muss – insbesondere bei der dynamischen Rechtsübernahme mit der Referendumsmöglichkeit.
Es muss ausserdem eine Regulierungskostenschätzung durchgeführt werden, welche die administrativen Mehrkosten für KMU als Folge der dynamischen Übernahme von EU-Recht ausweist.
«Bei Annahme der Juso-Zerstörungsinitiative droht eine enorme Aufblähung des Staates inklusive Verschwendung.»
Die Zahlungen an die EU müssen im Bundesbudget kompensiert und die Lohnkostensumme der Bundesverwaltung muss deutlich gesenkt werden. Auf den Ausbau des Kündigungsschutzes im Arbeitsrecht muss verzichtet werden. Zudem ist mit Bezug auf die Spesenregelung der Vorrang von Schweizer Recht gegenüber dem Völkerrecht sicherzustellen.
Eine wichtige Forderung des sgv ist die nach dem Ständemehr: Warum hält der Gewerbeverband dieses für zwingend?
Aufgrund der schieren Tragweite des Pakets. Mit den neuen Verträgen wird unsere wirtschaftspolitische Souveränität eingeschränkt. Eine solche Einschränkung muss demokratisch möglichst breit abgestützt werden.
Noch ein persönlicher Gedanke: Man hört in Bezug auf das Ständemehr derzeit vielfach das Argument, ein Urner habe damit mehr zu sagen als ein Zürcher. Wer so argumentiert, müsste sich in der Konsequenz auch für die Abschaffung des Zwei-Kammer-Systems und damit des Ständerats einsetzen. Was wohl niemand ernsthaft wollen kann.
Blicken wir noch auf den Abstimmungssonntag vom 30. November: Die JUSO-Initiative sorgt bereits seit langer Zeit für eine grosse Verunsicherung in der Schweizer Wirtschaft. Was macht sie so gefährlich?
Die Initiative mit ihrer gigantischen Erbschaftssteuer zerstört über Generationen aufgebaute Familienunternehmen, indem sie diese in den Ruin oder in den Ausverkauf an ausländische Konzerne treibt. Arbeitsplätze gehen verloren, und alle KMU bis zum kleinsten Zulieferer leiden.
Diese Zerstörungsinitiative der Juso rüttelt am Fundament unseres Wohlstands: Reiche, die sehr mobil sind und sehr viel Steuern zahlen, werden aus der Schweiz vertrieben und wandern auch nicht mehr zu. Es kommt zu grossen Steuerausfällen, und die Zeche zahlen die verbliebenen KMU und der Mittelstand.
Das Geld wollen die Jungsozialisten, denen die Reichen ihre Uni-Ausbildung bezahlen, zweckgebunden für den öko-sozialistischen Gesellschaftsumbau verwenden. Es droht eine enorme Aufblähung des Staates inklusive massiver Verschwendung und rot-grüner Günstlingswirtschaft.
Die Service-Citoyen-Initiative kommt ebenfalls Ende November an die Urne. Weshalb empfiehlt der sgv sie zur Ablehnung?
Weil sie den Fachkräftemangel verschärft, da viel mehr Leute am Arbeitsplatz fehlen werden. Das trifft insbesondere KMU mit kleiner Personaldecke überproportional. Es braucht eine Dienstpflicht für die Armee und den Zivilschutz. Das ist wichtig. Ich finde es aber falsch, einen Bürgerdienst einzuführen, der auf Bereiche wie beispielsweise «Umweltschutz» ausgedehnt würde. Am Schluss würde dann wohl auch noch ein Praktikum beim WWF, der regelmässig wirtschaftsfeindliche Initiativen mitträgt, als «Bürgerdienst» gelten. Und bezahlen würden all das – einmal mehr – die Unternehmen. Und wenn Dienstleistende Arbeiten übernehmen würden, die heute auf dem freien Markt erbracht werden, würden KMU vom Staat konkurrenziert und verdrängt. Diese Initiative ist klar KMU-schädlich und muss abgelehnt werden. Interview: Rolf Hug