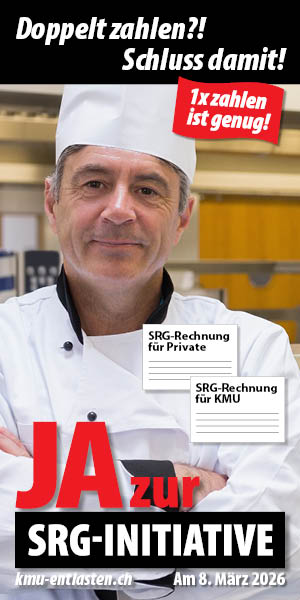In wenigen Jahren haben sich die Start-up-Gründer stark verändert. Suchten sie früher nach Unterstützung und Mitteln, um ihr heranwachsendes Geschäft zu entwickeln, werden viele von ihnen heute zu Finanzlobbyisten. So versuchen sie, möglichst schnell (manchmal künstlich) eine Geschäftsstruktur zu schaffen, die sich mit grösstmöglichem Gewinn verkaufen lässt.
Gefundenes Fressen für Grosse
So ist an den Hochschulen die Erstellung eines Businessplans Teil des akademischen Weges. In den vorgelegten Budgets sind die Gehälter dieser sehr jungen Unternehmer jedoch überproportional hoch zum Entwicklungsstand ihres Projekts angesetzt. Ein weiterer Beweis dafür, dass das Unternehmertum, welches Verzicht und Geduld erfordert, in den Gedanken von Fundraisern abhanden gekommen ist. Sie verlassen sich auf das Interesse grosser Unternehmen, die nur darauf warten, eine innovative Idee auf dem Markt kaufen zu können, statt eine eigene, teure Forschungsabteilung einzurichten.
Durch die Partnerschaft mit diesen neuen Chefs, die kurzfristig geschäften, hat sich auch der Investor in seiner Art verändert. Während er den Unternehmer einst mit allen damit verbundenen Risiken begleitete, um eine nachhaltige Struktur zu schaffen, werden sie heute zu reinen Spekulanten. Darüber hinaus sind Start-ups nicht mehr in der Stimmung, eine riskante Investition anzustreben, sondern bieten den Investoren im Gegenteil die Möglichkeit zu substanziellen und schnellen Gewinnen. Wenn das Projekt scheitert, welche Risiken sind sie noch eingegangen? Alleine diese Frage zu stellen, gibt die Antwort darauf.
Die Doppelrolle des Staates
Es gibt private und öffentliche Finanzierungsquellen für Start-ups, und die Jungunternehmer wissen, wie man sie nutzt. Während meiner zwölf Jahre, die ich an der Spitze der Bürgschaftsgenossenschaften verbrachte, bemerkte ich, dass die meisten Unternehmer, die eine Akte eingereicht hatten, zuvor an die Tür der Regierung geklopft hatten. Tatsächlich haben Wirtschaftsförderung und Steuerverwaltung Förderinstrumente entwickelt, die sehr gefragt sind.
Die Besonderheit der Bürgschaftsgenossenschaften besteht darin, den Banken, die den Unternehmen Geld leihen, Garantien zu bieten. Das ermöglicht eine berufliche Perspektive und mehr Sicherheit. In diesem Zusammenhang sollte sich die Rolle des Staates auf die Schaffung wirksamer Rahmenbedingungen beschränken. Und nicht durch direkte Garantien oder Spenden die Rolle des Investors spielen. Sonst besteht die Gefahr von willkürlichen Entscheidungen.
Der vom Kanton Waadt eingerichtete Unterstützungsfonds hat Rückschläge erlitten, die mit Unzulänglichkeiten der festgelegten Regeln erklärt wurden. Aber wie können wir bessere Regeln etablieren? Der Staat ist in vielen Bereichen zur Pflegemutter geworden. Nach liberaler Logik sollte er in einem Wirtschaftsraum, der nicht sein eigener ist, keine neuen Befugnisse erhalten. Seit dem 1. Juli 2019 verfügt die Bürgschaftsorganisation für KMU in der Schweiz über Finanzierungsbefugnisse von bis zu 1 Million Franken, finanziert von Bund und den Kantonen. Diese staatliche Unterstützung ist mehr als ausreichend. Wir sollten uns kein Beispiel an Frankreich nehmen, das diesbezüglich völlig falsch liegt. Ich hatte die Gelegenheit, ein Unternehmen zu begleiten, dem Frankreich eine Steuergutschrift für innovative Unternehmen gewährt hatte. Das Unternehmen profitierte davon fünfundzwanzig Jahre lang, da sein Ziel darin bestand, Computerentwicklung und damit Innovation zu betreiben! Eine solche Grosszügigkeit verfehlt ihr Ziel komplett und ist für die Wirtschaft ungesund. Deshalb muss der sgv – auch wenn dieses Thema gerade sehr in Mode ist – vorsichtig bei der Unterstützung der Finanzierungspolitik von Start-ups sein. Gerade wenn deren Chefs sich vorrangig an den Staat wenden, Investoren so behandeln, als wären sie ihnen verpflichtet, eine kurzfristige Politik des schnellen Verkaufs entwickeln und das meistens noch an eine grosse Gruppe, die dann sogleich den Standort verlagert.
Das Start-up, das zu einem nachhaltigen KMU wird, daran glaube ich immer weniger.
Jean-Pierre Wicht, Mitglied der Schweizerischen Gewerbekammer