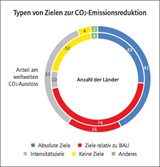Schweizerische Gewerbezeitung: Der Stellenetat der Bundesverwaltung steigt von Jahr zu Jahr – mit entsprechenden Kostenfolgen für die Steuerzahler. Was ist der Treiber hinter diesem steten Wachstum?
Reiner Eichenberger: Der eine Treiber ist klassisches Bürokratiewachstum: Infolge allgemeinen Wandels gibt es neue Aufgaben und alte werden unwichtiger. Für die neuen Aufgaben gibt es schneller neue Stellen als die unnötig gewordenen Stellen abgebaut werden. Schliesslich hat jeder Chef lieber mehr als weniger Mitarbeiter. Der zweite Treiber ist das Bevölkerungswachstum.
Konkret stieg die Zahl der Vollzeitstellen in der Bundesverwaltung zwischen dem Jahr 2000 und 2017 von 31 270 auf 34 962 – eine Zunahme um knapp 3700 Stellen oder rund 12 Prozent. Was kann die Politik tun, damit diese Zahlen nicht in den Himmel wachsen?
Das trifft zu. Aber die Bevölkerung wuchs in der Zeit um knapp 18 Prozent von 7,2 auf 8,5 Millionen. Die Zahl der Verwaltungsmitarbeiter pro Einwohner – die «Beamtendichte» – ist also sogar gesunken. Aber Vorsicht: Ohne wirksame «Beamtenbremse» wird langfristig das Bevölkerungswachstum voll auf die Verwaltungsgrösse durchschlagen. Denn üblicherweise wächst sie wenigstens proportional zur Bevölkerung. Deshalb haben grosse Länder, Kantone und Städte entsprechend mehr Beamte als kleine.
«jeder chef hat lieber mehr als weniger mitarbeiter.»
Der Skandal ist also nicht das gegenwärtige Verwaltungswachstum, sondern die irrige Meinung, dass es so etwas wie Grössenvorteile gäbe, also die Beamtendichte in grösseren Einheiten kleiner sei.
Und – was ist hier zu tun?
Das Problem ist nicht die Beamtenzahl an sich. Viele Beamte leisten sehr gute Arbeit. Sie lieben ihre Aufgabe und möchten beste Leistungen bieten. Dabei geht aber oft das Preis-Leistungs-Verhältnis vergessen. Andere verursachen hohe volkswirtschaftliche Kosten, indem sie durch unsinnige Regulierungen anderen die Arbeit erschweren. Leider wirkt ihre Tätigkeit kumulativ. Sie erlassen jedes Jahr neue Verordnungen, Weisungen etc., die über die Zeit eine giftige Zwangsjacke bilden. Entscheidend ist deshalb, dass die Beamten richtig eingesetzt werden. Das ist Aufgabe ihrer Vorgesetzten, also von Bundesrat und Parlament. Und da haben wir ernsthafte Probleme. Politiker, die die Altersvorsorge und die Unternehmenssteuern nicht vernünftig reformieren können, können auch die Verwaltung nicht im Zaum halten.
Laut Bundesamt für Statistik betrug der mittlere Lohn im privaten Sektor rund 6100 Franken pro Monat; im öffentlichen Sektor liegt er bei knapp 8000 Franken. Wie erklären Sie sich diese Differenz?
Natürlich gibt es manche Bereiche, in denen der Staat zu gut zahlt. Ein grosser Teil des Unterschieds resultiert aber daraus, dass beim Staat viele weniger spezialisierte Tätigkeiten, etwa Raumreinigung und Verpflegung, an private Firmen ausgelagert wurden. Dadurch steigt der Durchschnittslohn beim Staat und sinkt derjenige bei den Privaten.
Rund 44 Prozent der Angestellten in der Bundesverwaltung verfügen über einen tertiären Abschluss, und sie verdienen im Durchschnitt besser als private Angestellte. Ist es richtig, von ihnen eine sehr effiziente Arbeit zu erwarten?
Ja klar. Aber es gibt zwei Probleme. Erstens ist der Staat oft Monopolist für seine Leistungen. Zweitens erbringt er sie zumeist für Kunden, die die Leistungen nicht selbst bezahlen. Bezahlt wird aus dem allgemeinen Steuertopf. Da ist klar, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis oft vergessen geht.
Nun wird die Produktivität der Bundesverwaltung laut Bundesrat aber gar nicht gemessen – eine Haltung, die sich Privatunternehmen so nicht leisten können. Was halten Sie von dieser Tatsache vor dem Hintergrund der knapper werdenden öffentlichen Finanzen?
Es ist noch schlimmer. Produktivität ist ja das Verhältnis von Output zu Input. Doch der Output des Staates ist sehr schwer zu messen. Denjenigen von Privatfirmen kann man anhand der Marktpreise erfassen. Solche aber gibt es für die meisten staatlichen Leistungen nicht.
«leider wirkt die Arbeit der beamten kumulativ. sie erlassen jedes jahr neue vorschriften.»
Staatlich festgelegte Preise hingegen sind kein vernünftiges Outputmass. Wenn man die Produktivität des Staates anhand der Werte seiner Leistungen misst, erhöht er seine Monopolpreise und so die Werte. Wenn man die Produktivität an den Produktionsmengen misst, erhöht er die Mengen auf Kosten der Qualität.
Wie kann sichergestellt werden, dass die Bundesverwaltung ihre Produktivität steigert und tatsächlich effizienter arbeitet?
Der Weg zu mehr Effizienz führt über mehr Wettbewerb. Wettbewerb kann an ganz verschiedenen Orten ansetzen, etwa dass Kunden wählen können, wo sie ihre Leistungen beziehen; dass Steuerzahler wählen können, wer die Leistung erbringen soll; dass die Bürger wählen können, wer die Verwaltung kontrolliert; dass innerhalb der Verwaltung ein wettbewerblicher Arbeitsmarkt etabliert wird. Richtig angelegter Wettbewerb bringt nicht nur eine bessere Kontrolle der Verwaltung, sondern er ist stark motivierend und ein Entdeckungsverfahren. Konkurrenten lernen viel voneinander und kommen auf ganz neue Lösungen.
Welche Unterstützung kann die Wissenschaft in dieser Frage leisten?
Sehr viel. Die Bedingungen in den verschiedenen Verwaltungsbereichen sind ganz unterschiedlich. Darauf ist Rücksicht zu nehmen. Falsch organisierter Wettbewerb und Kontrolle wirkt sich negativ aus. Wenn beispielsweise nur Preiswettbewerb zugelassen wird, kann das auf die Qualität schlagen. Oder wenn die Kontrollinstanzen nur Fehler rügen, wird die Verwaltung übervorsichtig. Sehr wichtig ist, dass die Motivation der Verwaltungsmitarbeiter, gute Leistungen zu erbringen, erhalten und gestärkt wird. Entscheidend dafür ist die richtige Personalselektion und neben Kontrolle auch viel Autonomie. Zudem braucht es ein konstruktiv-kritisches Feedback von denen, um die es geht: die Bürger.
Wie verhält sich die Entwicklung der öffentlichen Verwaltung in Deutschland und Österreich im Vergleich zu jener in der Schweiz?
Wie so oft klagen wir auf hohem Niveau. Im internationalen Vergleich ist unsere Verwaltung schon fast grossartig. Aber: Das ist ein Vergleich mit Kranken und Fusslahmen. Die Verwaltungen sind in vielen Ländern in vielen Bereichen einfach schrecklich bürokratisch und bürgerfern. Unser Problem ist, dass wir unser Potenzial bei weitem nicht ausnutzen, weil wir uns oft mit Ländern vergleichen, die niemand als Vorbild sieht. Wichtig wäre deshalb ein kluges Benchmarking. Die Leistungen und Bedingungen in der Schweiz sollten systematisch und regelmässig mit den relativ leistungsfähigen Staaten und Regionen verglichen werden: den skandinavischen Staaten, den Niederlanden, den erfolgreichen deutschen Bundesländern, Österreich, Luxemburg, Südtirol und Singapur. Aus solchen Vergleichen kann man sehr viel lernen, und es befreit die Reformkräfte, wenn man sieht, wie andere manches besser machen. Aber unser Bundesrat erzählt lieber, wir hätten eine tiefe Staatsquote und tiefe Arbeitslosigkeit – dabei ist das grossenteils nur durch die Messtechnik bedingt. Es wäre seine Pflicht, ein vernünftiges Vergleichssystem zu etablieren. Dabei wäre es dann auch wichtig, verschiedene Bezugsgrössen zu wählen.
«In franken pro einwohner haben wir fast den teuersten staat der welt.»
So haben wir auch nach notwendigen Anpassungen (etwa 2. Säule und Krankenkassenprämien) noch einen leicht schlankeren Staat als Deutschland – wenn man auf die Fiskalquote schaut, also Zwangsabgaben dividiert durch das Bruttoinlandprodukt. In Franken pro Einwohner aber haben wir fast den teuersten Staat der Welt.
Nun wird im Parlament nicht bloss bemängelt, die Verwaltung arbeite zu wenig effektiv, sondern auch, dass sie sich – jüngst etwa rund um den Vaterschaftsurlaub, bei der Gleichstellungsdebatte oder bei der Frage nach Rüstungsexporten –zeitnah in den Entscheidfindungsprozess einmische. Damit nehme sie zugleich einen ungebührlichen Einfluss auf die Politik, aber auch auch auf die öffentliche Meinung. Wie beurteilen Sie solche Fälle vermeintlicher «Polit-Propaganda»?
Das ist eine schwierige Frage. Mir ist unklar, ob die Verwaltung zunehmend eigene Ziele verfolgt, das Parlament schwächer geworden ist, oder die Bundesräte ihre Departemente zunehmend als ihr eigenes Gärtchen sehen und ihren Verwaltungen praktisch parteipolitische Aufgaben übergeben. Zuweilen habe ich das Gefühl, es ist alles zusammen.
Sehen Sie konkrete Beispiele, wo die Bundesverwaltung ihre Kompetenzen überschritten und ihre Rolle – Vorbereitung, Anwendung und Vollzug von Gesetzen – ausgedehnt und sich quasi als Gesetzgeber gebärdet hat?
Klar gibt es solche Beispiele: Geldwäscherei, Zuwanderung, Kinderbetreuung durch Bekannte und Verwandte etc. Ein Einfallstor sind Verordnungen und Weisungen, die stark mitbestimmen, wie sich Gesetze auswirken. Das andere ist die Vorbereitung von Gesetzesentwürfen und Entscheidungen im Bundesrat. Welche Position da die Verwaltung hat, ist natürlich mitentscheidend für die Politik.
Was muss getan werden, damit die Politik die Fäden wieder stärker in der Hand behalten und der Einfluss der Verwaltung auf politische Entscheide zurückgebunden werden kann?
Der Bundesrat muss homogener werden. Heute machen Bundesräte oft reine Parteipolitik. Doch der Bundesrat wird in einer Mehrheitswahl vom Parlament gewählt. Diese sollte eigentlich dazu führen, dass die Bundesräte stark in der politischen Mitte verwurzelt sind und sich wegen des intensiven Wettbewerbs unter den vielen Mittepolitikern durch hohe Kompetenz auszeichnen müssen, sprich dass rechte Linke und linke Rechte gewählt werden, die dann gut zusammenarbeiten und als geeinter Bundesrat auftreten und auch die Verwaltung kontrollieren können. Heute läuft es leider anders. Manche Parteien möchten am liebsten nur einen Kandidaten für «ihren» Bundesratssitz aufstellen, oder die Wahl nicht aufgestellter Kandidaten nicht akzeptieren. Das ist absurd: Die Parteien sollten wenigstens zwei, besser drei oder sogar mehr Kandidaten aufstellen, und die Bundesversammlung sollte sich frei fühlen, andere als die aufgestellten Kandidaten zu wählen. Noch besser wäre eine Volkswahl oder eine kluge Mischung aus Volks- und Parlamentswahl. So könnte das Volk in einer Mehrheitswahl entscheiden, welche Partei wie viele Sitze bekommen soll, und das Parlament die Köpfe dafür bestimmen. Oder das Parlament könnte für die Erstwahl zuständig sein und das Volk für die Wiederwahl bzw. Nicht-Wiederwahl.
Sodann muss man den Einfluss des Volks stärken. Wie das geht, kann man von den Gemeinden lernen. Da wählt das Volk nicht nur die Regierung, sondern auch die Kritik- und Kontrollbehörde, die Rechnungs- oder Geschäftsprüfungskommissionen. Diese spielen eine enorm fruchtbare Rolle. Solche volksgewählten Kommissionen könnten auch auf Bundes- und Kantonsebene eingesetzt werden, gerade auch zur Verwaltungskontrolle, etwa zur Überprüfung von Verordnungen, zur Identifikation von bürokratischem Unsinn, oder zur Entwicklung von Gegenvorschlägen zu den Parlamentsentscheiden. Wichtig ist, dass sie nichts selbst entscheiden können, aber Vorschläge für Volksabstimmungen machen können.
Bleiben wir bei den Kommissionen: In der Herbstsession wurden mehrere Vorstösse eingereicht, die nach den Kosten der knapp 120 ausserparlamentarischen Kommissionen mit ihren rund 1500 Mitgliedern – inklusive zwölf Mitgliedern des Parlaments und ca. 100 Mitarbeitende der Bundesverwaltung – fragen. Welchen Wert messen Sie solchen Kommissionen bei?
Grundsätzlich sind auch solche Kommissionen – die oben vorgeschlagene ist etwas ganz anderes – eine sehr gute Sache. Durch sie kann externes Fachwissen ins Verwaltungshandeln kommen, und von Interessenpolitik unabhängige Entscheidungen werden möglich, wie etwa im Fall von unabhängigen Regulierungskommissionen. Zudem können auch Querschnittaufgaben in der Verwaltung so gut angegangen werden. Wie immer droht aber, dass unter dem Deckmantel des Guten auch Schlechtes verkauft wird.
Oft seien solche Kommissionen reine Lobby-Veranstaltungen, hört man aus Kreisen des Parlaments. Reicht es nicht, wenn Parteien und Verbände, deren Aufgabe ganz direkt das Lobbyieren ist, zur Vorbereitung von Gesetzesentwürfen beigezogen werden? Anders gefragt: Weshalb braucht es solche Kommissionen überhaupt, und warum in dieser Anzahl?
Viele der Kommissionen machen hervorragende, sachorientierte, unabhängige Arbeit.
«VERORDNUNGEN UND WEISUNGEN: Sie sind Das EINFALLSTORFÜR DIE EINMISCHUNG DER VERWALTUNGIN DIE POLITIK.»
Angesichts der grossen Zahl und völlig unterschiedlichen Strukturen dieser Kommission sollte man da nichts generalisieren. Die Kritik, die Kommissionen seien teuer, halte ich für hinfällig. Denn wie immer gilt: In der Politik geht es um so viel Geld, dass die Entschädigungen der Entscheidungsträger relativ unwichtig sind. Ein Gremium, das die Politik schon nur leicht verbessert, bringt zumeist sehr viel mehr Nutzen als Kosten. Interview: Gerhard Enggist